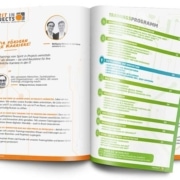Wichtige Anforderungskategorien in KI-Projekten
In der Praxis von KI-Projekten zeigen sich oft spezifische Anforderungsblöcke, die über die klassischen funktionalen, nicht-funktionalen oder rein datenbezogenen Kategorien hinausgehen. Wichtige Bereiche sind etwa Daten & Datenqualität, Modell & Algorithmen, Integration & Betrieb, Benutzer & Domäne sowie Sicherheit & Ethik. Jede dieser Kategorien bringt besondere Fragestellungen mit sich, die im Projekt frühzeitig geklärt werden sollten.

Daten und Datenqualität
KI lebt von Daten: Sie sind das Fundament jeder KI-Anwendung. Im Vergleich zu klassischen Softwareprojekten steht hier die Qualität, Quantität und Diversität der Daten im Fokus. Schlechte oder einseitige Daten führen unweigerlich zu falschen Vorhersagen oder Verzerrungen. In der Praxis müssen daher frühzeitig Fragen geklärt werden wie: Woher stammen die Daten? Sind sie vollständig, aktuell und korrekt aufbereitet? Stehen ausreichend viele repräsentative Trainingsdaten zur Verfügung? Wie werden sie annotiert und versioniert?
Checkliste:
- Sind alle benötigten Datenquellen identifiziert, zugänglich und dokumentiert?
- Entsprechen Datenstruktur und -format den Anforderungen des Modells?
- Wurde eine Datenbereinigung durchgeführt (fehlende Werte, Ausreißer, Korrektur) und sind Qualitäts-Checks implementiert?
- Sind Datenschutz und Nutzungsrechte (z. B. DSGVO, Urheberrecht) geklärt und angewendet?
Modell und Algorithmus
Nachdem die Datenbasis steht, stellt sich die Frage nach dem passenden Lernverfahren. Hier geht es um die Wahl von Algorithmus und Modellarchitektur sowie um Leistungs- und Evaluationskriterien. Entscheidend ist zunächst zu klären, welcher Algorithmus zum Use Case passt (z. B. Klassifikation, Regression, Clustering) und welche Zielmetriken (z. B. Genauigkeit, Precision/Recall) erreicht werden sollen. Auch Anforderungen an Erklärbarkeit (Explainability) oder Robustheit (z. B. gegen Ausreißer oder Adversarial-Angriffe) fließen in diese Kategorie ein.
Checkliste:
- Welcher KI-Algorithmus und welche Modellarchitektur werden eingesetzt?
- Welche Zielwerte (Accuracy, etc.) oder Benchmarks müssen erreicht werden?
- Sind Anforderungen an Interpretierbarkeit, Transparenz oder Erklärbarkeit definiert?
- Wie wird Modell-Drift überwacht und wie häufig erfolgt ein Nachtraining?
Integration und Betrieb (MLOps)
Anders als bei herkömmlicher Software endet die Arbeit mit einem KI-Modell nicht nach dem Deployment. Das Modell muss dauerhaft in die Systemlandschaft integriert und im Betrieb gepflegt werden. Wesentliche Punkte sind hier: Welches System und welche Infrastruktur wird genutzt (Cloud vs. On-Premise, GPU/CPU)? Wie erfolgt das Deployment (z. B. CI/CD-Pipeline) und das Release-Management? Gibt es klar definierte Schnittstellen und Datenflüsse (APIs, Datenbanken, Messaging-Systeme)? Sind Service-Level (z. B. Antwortzeiten, Verfügbarkeit) definiert und gesichert? Experten betonen, dass KI-Lösungen nicht als Insellösung konzipiert werden sollten, sondern nahtlos in bestehende Prozesse integriert werden müssen.
Checkliste:
- Ist die Ziel-Infrastruktur (Cloud/On-Premise, Hardware-Anforderungen) definiert und verfügbar?
- Sind alle Schnittstellen (APIs, Datenbanken, Authentifizierung) spezifiziert und getestet?
- Gibt es ein Monitoring (Leistungs-KPIs, Daten-/Modell-Drift) und Alarmierungen im Live-Betrieb?
- Wie sind der Release-Prozess und die Verantwortlichkeiten für Betrieb & Wartung geregelt (DevOps/MLOps)?
Benutzer, Domäne und Organisation
Ein KI-Projekt ist nur so erfolgreich wie seine Akzeptanz bei den Nutzern. Daher ist die Einbindung von Domänenexperten und Endanwendern essenziell. Welche konkreten Geschäftsprozesse werden automatisiert oder unterstützt? Welche Benutzerrollen (z. B. Endanwender, Administratoren, Data Scientists) gibt es und wie sollen sie mit dem System interagieren (Dashboards, Alerts, Berichte)? Zudem muss oft explizit definiert werden, wie die KI die Arbeit der Mitarbeiter ergänzt: Soll sie Empfehlungen geben, Entscheidungen treffen oder nur Vorschläge liefern?
Checkliste:
- Sind alle relevanten Benutzerrollen und ihre Anforderungen definiert?
- Wie werden KI-Ergebnisse präsentiert (z. B. Dashboard, Berichte, Alerts) und interpretiert?
- Gibt es Interaktions- oder Rückmeldemöglichkeiten für die Anwender (z. B. Korrektur, Feedback)?
- Sind Trainings- und Akzeptanzmaßnahmen für die Anwender vorgesehen (Change Management)?
Sicherheit, Ethik und Compliance
KI-Projekte bringen oft zusätzliche rechtliche und ethische Anforderungen. Besonders bei sensiblen oder personenbezogenen Daten muss der Datenschutz (z. B. DSGVO) strikt eingehalten werden. Das umfasst u. a. informierte Einwilligung, Datenminimierung und sichere Speicherung. Gleichzeitig ist Fairness ein zentrales Thema: Verzerrungen in den Daten oder Modellen können zu diskriminierenden Ergebnissen führen (so genannter Algorithmic Bias). Auch andere Regularien (z. B. der EU AI Act oder branchenspezifische Vorgaben) sind hier relevant.
Checkliste:
- Sind alle Datenschutz-Anforderungen (Einwilligung, Anonymisierung, DSGVO-Compliance) geklärt?
- Wurden Trainingsdaten und Modelle auf Bias und Fairness geprüft?
- Sind Nachvollziehbarkeit und Erklärbarkeit der KI-Entscheidungen definiert (Audit-Trail, Logging)?
- Wie werden Modelle und Daten gegen Angriffe und Manipulation geschützt?
Fazit
Insgesamt erfordern KI-Projekte eine ganzheitliche Anforderungsanalyse, die technische, fachliche und regulatorische Aspekte vereint. Die obigen Kategorien – abgeleitet aus Praxiserfahrung – helfen Projektleitern und Entscheidern, typischerweise übersehene Punkte systematisch abzuarbeiten. Eine klare Zieldefinition und ein iteratives Vorgehen (MVP, Prototypen) runden das Bild ab und verhindern unerwünschte Überraschungen.




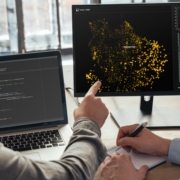
 pixabay/geralt
pixabay/geralt